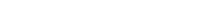Medienvertrauen: Warum Glaubwürdigkeit stärker wirkt als Lautstärke
Medien sind Vermittler zwischen Realität und Wahrnehmung. Wer über sie debattiert, spricht immer auch über Vertrauen. Ein solches Medienvertrauen ist kein flüchtiges Gut. Es entsteht langsam, durch Konsistenz, durch die erkennbare Mühe um Wahrheit – und geht schnell verloren, wenn der Ton schrill wird.
Auf Unternehmen, Institutionen und Organisationen übertragen heißt das: Der langfristige Erfolg ihrer PR-Kommunikation hängt weniger davon ab, wie laut sie auftritt, sondern wie glaubwürdig sie ist.
Medienvertrauen als Gradmesser unserer Gesellschaft
Der Begriff Medienvertrauen beschreibt zunächst einmal die Überzeugung, dass veröffentlichte Informationen verlässlich, überprüfbar und im Kern richtig sind. Studien zeigen: Dieses Vertrauen ist kein starres Phänomen, sondern spiegelt immer die jeweiligen gesellschaftlichen Stimmungen wider. Laut einer aktuellen Untersuchung von Infratest dimap im Auftrag des WDR („Vertrauen im Aufschwung – Medien gewinnen an Glaubwürdigkeit“, 2025) geben 61 Prozent der Deutschen an, Medienberichterstattung für glaubwürdig zu halten – immerhin fünf Prozentpunkte mehr als im Jahr davor.
Die Johannes-Gutenberg-Universität Mainz kommt zu einem ähnlichen Schluss: Das Vertrauen in etablierte Medien sei nach Jahren der Verunsicherung in Deutschland wieder weitgehend stabil.
Dies zeigt: Medienvertrauen ist ein empfindliches Barometer für gesellschaftliche Orientierung. In einer Landschaft, in der Informationen sekündlich entstehen und verschwinden, wächst also die Bedeutung glaubwürdiger Quellen – und damit die Verantwortung derjenigen, die Inhalte gestalten.
Die zweistufige Wirkweise des Medienvertrauens
Denn Medienvertrauen wirkt auf zwei Ebenen. Es ist nicht nur ein Maßstab dafür, wie Menschen Medien wahrnehmen – es bestimmt in der Folge auch, wie Medien Unternehmen wahrnehmen.
Journalist:innen vertrauen Quellen, die sorgfältig arbeiten, Fakten offenlegen und auf Augenhöhe kommunizieren. Wer als Organisation konsistent, transparent und erreichbar ist, gewinnt das Vertrauen der Redaktionen. Und dieses Vertrauen ist die Grundlage jeder erfolgreichen Medienarbeit: Nur wer als glaubwürdig gilt, wird auch gehört und zitiert.
Was sinkendes oder steigendes Medienvertrauen für Ihre PR bedeutet
Medienvertrauen richtet sich in erster Linie an Journalist:innen, Redaktionen und die Glaubwürdigkeit ihrer Arbeit. Wenn die Bevölkerung den Medien misstraut, stellt das jedoch auch die Öffentlichkeitsarbeit von Unternehmen und Institutionen vor eine Herausforderung – denn sie agiert im selben Kommunikationsraum.
Unternehmen, Organisationen und PR-Agenturen bewegen sich also in einem Ökosystem der Vermittlung. Und sie sind darauf angewiesen, dass Medien als glaubwürdige Partner gelten und dass auch sie den Medien ein glaubwürdiger Partner sind. Wie das geht?
PR hat Verantwortung
Ein überladener, schriller oder zu werblicher Pressetext, der mehr verspricht als belegt, schwächt dieses Vertrauen. Eine faktenbasierte, transparente und journalistisch anschlussfähige Kommunikation hingegen stärkt es.
Für die PR-Praxis heißt das: Verantwortung vor Reichweite. Wer Medienvertrauen stärken will, muss Kommunikation als Beitrag zur öffentlichen Diskursqualität verstehen, nicht als reines Reichweitenspiel.
Lautstärke verführt, doch Substanz überzeugt
Viele Kommunikationsstrategien zielen aber immer noch rein auf Reichweite. Hohe Klickzahlen, virale Posts, starke Emotionen. Das erzeugt Awareness, aber noch längst kein Vertrauen. Denn was laut ist, wird schnell als inszeniert wahrgenommen. Und wer zu oft überzieht, läuft Gefahr, seine Botschaften zu entwerten.
Glaubwürdigkeit dagegen wächst leise. Sie entsteht durch Relevanz, durch nachvollziehbare Quellen, durch den Mut zur Einordnung. Eine Aussage, die erklärt, statt bis aufs Äußerste zu verkürzen, bleibt haften. Eine Marke, die Haltung zeigt, statt nur Zustimmung zu suchen, bleibt glaubwürdig.
Seriöse PR folgt deshalb einem einfachen Prinzip: Wirkung entsteht nicht durch Lautstärke, sondern durch Verlässlichkeit. Auch unsere Agentur hat sich dieses Prinzip auf die Fahnen geschrieben. Eben Substanz statt Hype.
Das Vertrauen der Medien gewinnen: 5 Schritte für eine nachhaltige Kommunikationsstrategie
Das Vertrauen der Medien lässt sich nicht erzwingen. Aber man kann Bedingungen schaffen, unter denen es wächst. In unserer Arbeit bei Public Affairs, der PR-Unit der Counterpart Group, haben wir dazu diese fünf grundsätzlichen Schritte definiert.
1. Zuhören, bevor man spricht
Wer Vertrauen aufbauen will, muss zuerst verstehen, wer sein Gegenüber ist. Welche Themen bewegen die Zielgruppen? Welche Medien genießen in diesen Gruppen Glaubwürdigkeit? Eine sorgfältige Umfeldanalyse verhindert, dass Botschaften ins Leere laufen.
2. Themen mit Substanz entwickeln
Hinter jeder guten Kommunikation steht ein echtes Anliegen. Themen, die Relevanz haben, halten länger als Kampagnen, die nur kurzfristige Trends bedienen. Gute PR-Arbeit bedeutet, Bedeutung und Mehrwert zu schaffen.
3. Die richtigen Kanäle wählen
Das Vertrauen der Medien in die PR eines Unternehmens oder einer Institution entsteht dort, wo journalistische Qualität spürbar ist: in Fachtexten mit der passenden Informationstiefe, in qualitativen Statements und Interviews, die einordnen, statt nur zu multiplizieren.
4. Transparenz und Kontinuität leben
Einmalige Auftritte können Aufmerksamkeit schaffen. Kontinuität schafft hingegen Verlässlichkeit. Wer regelmäßig offen kommuniziert, Entwicklungen erklärt und wenn nötig auch Fehler einräumt, signalisiert Öffentlichkeit und Medien Integrität – eine zentrale Voraussetzung für Vertrauen.
5. Erfolg an Glaubwürdigkeit messen
Erfolg misst sich nicht nur in Reichweiten, sondern in Resonanz. Welche Reaktionen lösen Ihre Botschaften in der öffentlichen Wahrnehmung aus? Werden sie geteilt, diskutiert, weitergedacht? Entscheidend ist nicht, wie viele Menschen Sie erreicht haben, sondern wie glaubwürdig Sie sind.
Medienvertrauen ist ein langfristiges Kapital
Das Vertrauen der Öffentlichkeit und der Medien ist ein Vermögenswert in der PR – nur schwer aufzubauen, aber schnell verloren. Fehlende Transparenz oder opportunistische Kommunikation beschädigen ihn dauerhaft.
Studien zeigen, dass die Reputation einer Marke eng mit ihrer Wahrnehmung als glaubwürdig verbunden ist. Viele meiden Marken, die sie als „kommunikativ unaufrichtig“ empfinden.
Die gute Nachricht: Glaubwürdigkeit lässt sich gestalten. Nicht durch Perfektion, aber durch Haltung. Wer konsistent, faktentreu und nachvollziehbar kommuniziert, stärkt das Vertrauen der Medien und der Öffentlichkeit in die eigene Marke.
Was gute Agenturen leisten können
Gute Agenturen begleiten diesen Prozess nicht als Lautsprecher, sondern als Lotsen.
Das PR-Team von Public Affairs entwickelt Themen so, dass sie inhaltlich tragen und journalistisch bestehen. Das bedeutet:
- strategische Themenführung, um Relevanz über Monate zu sichern,
- Beziehungsarbeit mit Redaktionen, statt bloßer Versand von Mitteilungen,
- inhaltliche Tiefe durch Interviews, Fachbeiträge und Hintergrundformate,
- Evaluation der Wahrnehmung, das macht Vertrauen messbar.
So entsteht Kommunikation, die Bestand hat – und Medienvertrauen, das über einzelne PR-Kampagnen hinaus wirkt.
Wenn Sie Ihre Kommunikationsstrategie stärker auf Glaubwürdigkeit, Tiefe und langfristiges Vertrauen ausrichten möchten, begleiten wir Sie gerne. Wir entwickeln und steuern PR-Strategien, die Vertrauen aufbauen – bei Journalist:innen, Stakeholder:innen und in der Öffentlichkeit.
Schreiben Sie uns unter big-hit@public-affairs.de. Gemeinsam bringen wir Substanz dorthin, wo heute noch Lautstärke regiert.
Autorin: Sonja Müller
Beitrag vom 18.11.2025